Kehlkopfkrebs
Der Kehlkopf spielt eine wichtige Rolle bei der Atmung, der Stimmbildung und der Trennung des Luftweges vom Speiseweg.
Häufigstes Symptom von Kehlkopfkrebs ist Heiserkeit: Da Kehlkopfkrebs oftmals von den Stimmbändern ausgeht und dadurch eine langandauernde Heiserkeit auslöst, wird diese Krebserkrankung meist früh erkannt. Eine Heiserkeit, die über 3 Wochen besteht, sollte immer durch eine/ einen HNO- Ärztin/Arzt abgeklärt werden.
Die Diagnose erfolgt mittels einer indirekten Kehlkopfspiegelung und einer Untersuchung in Narkose, bei der auch Gewebeproben entnommen werden (Biopsie). Zusätzlich kommen bildgebende Verfahren wie Sonographie, Computertomographie oder Magnetresonanztomographie zum Einsatz.
Therapie: Kleine Kehlkopfkarzinome können sehr gut und unter größtmöglichem Erhalt der Kehlkopffunktion chirurgisch entfernt werden. Bei fortgeschrittenen Tumoren werden auch Strahlentherapie oder kombinierte Strahlen- und Chemotherapie angewandt.
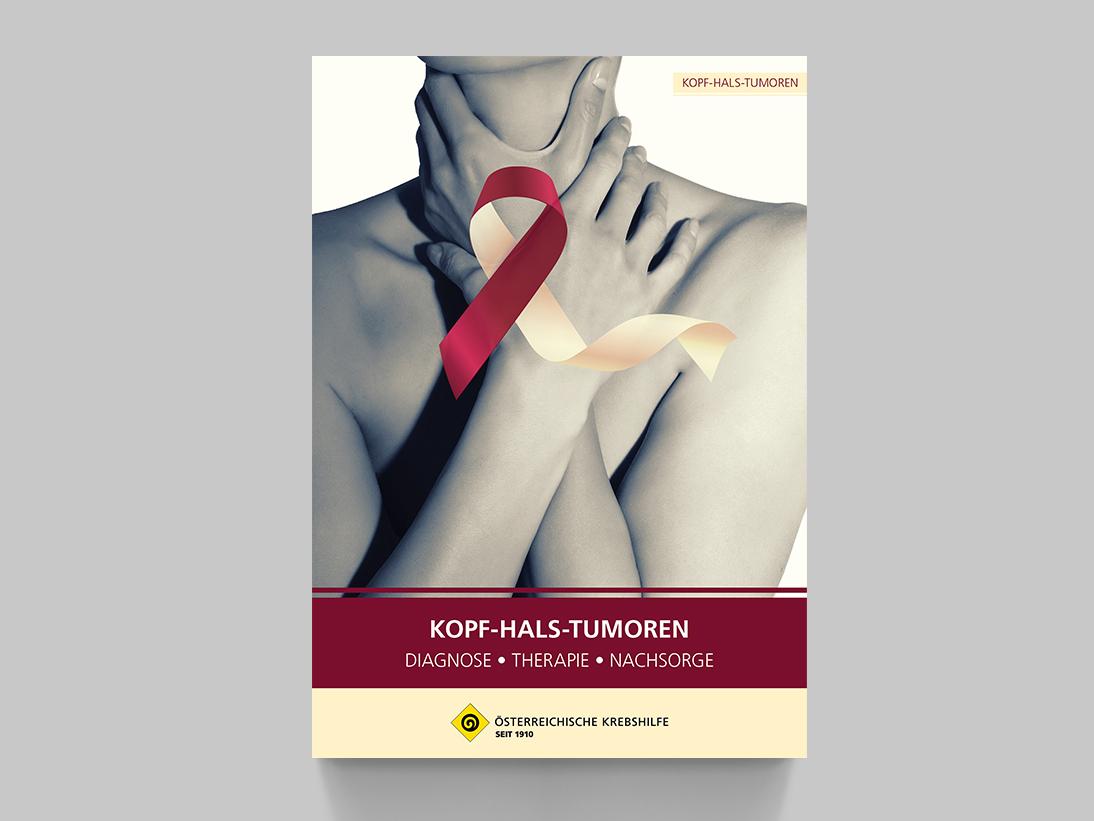
Broschüre Kopf-Hals-Tumoren
Weitere Informationen zu Symptomen, Diagnose und Therapie von Kehlkopfkrebs erhalten Sie in der Krebshilfe-Broschüre „Kopf-Hals-Tumoren“.
