Gebärmutterhalbskrebs
Die oberen zwei Drittel der Gebärmutter werden als GebärmutterKÖRPER (Corpus) bezeichnet, und das untere Drittel als GebärmutterHALS (Zervix), der in den Muttermund (Portio) übergeht.
Der Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) entwickelt sich meistens in den obersten Zellschichten der Schleimhaut des Muttermundes, wobei 90 %sogenannte Plattenepithelkarzinomesind. Die Entstehung des Zervixkarzinoms ist eng mit einer Infektion durch sogenannte Humane Papillomaviren(HPV) verbunden. Diese Viren werden z. B. beim Geschlechtsverkehr übertragen.
Diagnose: Die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs kündigt sich über verschieden Vorstufen an, die durch eine Krebsabstrichuntersuchung(PAP-Abstrich)bzw. einer Probebiopsie diagnostiziert wird. Ist der Krebsabstrich auffällig, erfolgt eine Gebärmutterhalsspiegelung (Kolposkopie),d.h.eine Untersuchung desGebärmuttermunds sowie des sichtbaren Teils des Gebärmutterhalskanals mit Hilfe eines speziellen Mikroskops. Werden veränderte Gewebestellen entdeckt, wird eine feingeweblicheUntersuchung (Histologie) mittels einer Probenentnahme (Biopsie) durchgeführt.
Die Behandlung sollte in spezialisierten Zentren erfolgen – eine Auflistung der zertifizierten gynäkologischen Zentren in Österreich finden Sie hier.
Die Therapie erfolgt je nach Stadium des Zervixkarzinoms. Operation, Strahlen- und Chemotherapie stehen zur Verfügung. Die Heilungsaussichten von Gebärmutterhalskrebs sind sehr gut.
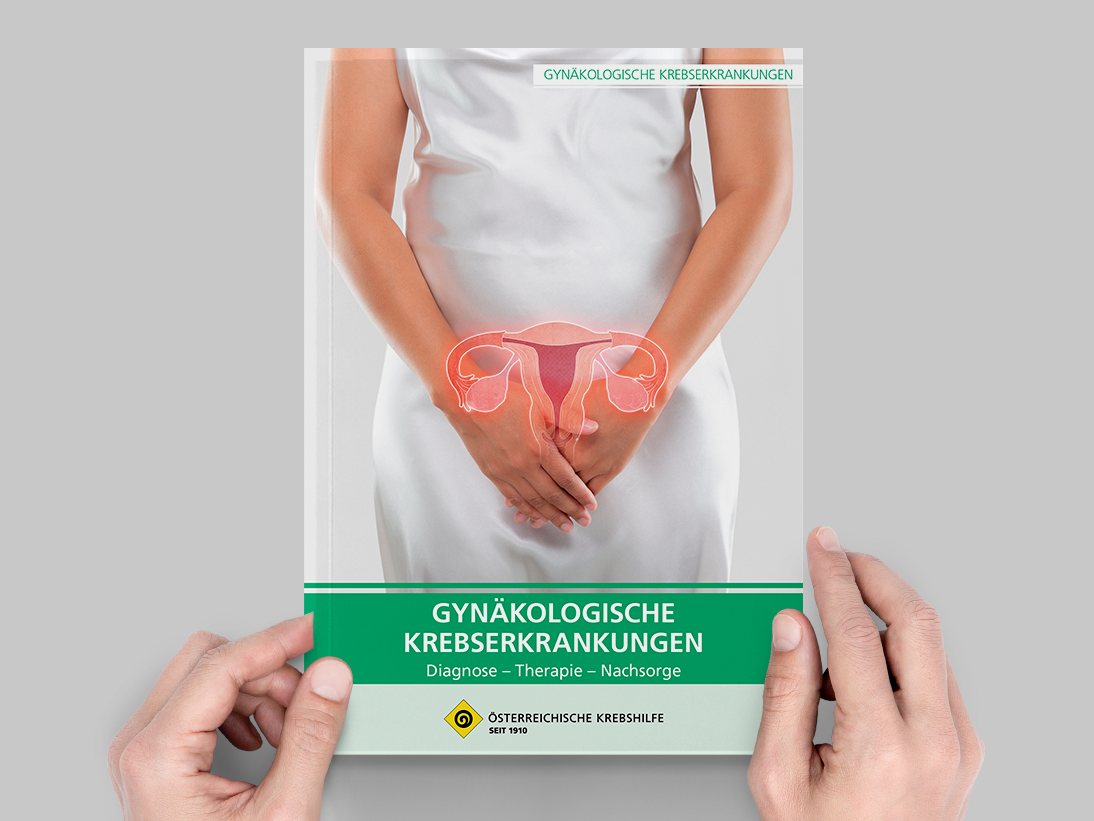
Broschüre Gynäkologische Krebserkrankungen
Ausführliche Informationen zu Diagnose, Therapie und Nachsorge von Gebärmutterhalskrebs erhalten Sie in der Krebshilfe-Broschüre "Gynäkologische Krebserkrankungen".
Seit einigen Jahren können sich Krankenhäuser mit viel Erfahrung in der Behandlung von Unterleibskrebs als „Zentrum für Gynäkologische Tumoren“ zertifizieren lassen. Die Behandlung von Gebärmutterhalskrebs sollte in solchen Zentren erfolgen.
